BALTWRECK
Verhinderung von massiven chemischen Verschmutzungen der Meeresgewässer durch leckgeschlagene Wracks und verklappte Munitionsreste in der südlichen Ostsee

Das BALTWRECK Projekt
Verhinderung von massiven chemischen Verschmutzungen der Meeresgewässer durch leckgeschlagene Wracks und verklappte Munitionsreste in der südlichen Ostsee
Der maritime Sektor steht vor zahlreichen Herausforderungen, insbesondere im Bereich des Managements historischer Schiffswracks und der damit verbundenen Umweltgefährdung. Es wird angenommen, dass über 20000 Wracks am Grund der Ostsee liegen. Durch die teilweise immer noch an Bord befindlichen Betriebsstoffe und die geladene Fracht bergen diese Wracks ein erhebliches ökologisches und wirtschaftliches Schadensrisiko. Besonders die geladene Munition korrodiert immer stärker und entlässt dabei Sprengstoffe in das umgebende Meerwasser. Diese, so sowie deren Zerfallsprodukte, können Zusehens zur Beeinträchtigung der Umwelt führen. Das Vorkommen von Munitionsresten ist jedoch nicht nur auf Wracks beschränkt. In Nord- und Ostsee wurden nach den Weltkriegen tonnenweise Munition zur Entsorgung versenkt (verklappt), wodurch eine erhebliche Ansammlung am Meeresboden entstand. Die spezifischen Herausforderungen beim Schutz von Mensch und Umwelt liegen in der Lokalisierung, Identifizierung, Bewertung und gegebenenfalls Bergung dieser Munition. Erste Schritte wurden bereits in früheren Projekten (zum Beispiel dem North Sea Wrecks Projekt) gegangen. In BALTWRECK werden diese, mit einem Fokus auf die Anpassung an regionale Gegebenheiten und der Integration neuer Datenquellen, fortgesetzt.
BALTWRECK läuft von Juli 2024 bis Juni 2027 und hat die Entwicklung und Implementierung von Lösungen zur Bewertung und Verwaltung von Schiffswracks und verklappter Munition in der südlichen Ostsee zum Ziel. Zudem liegt ein Fokus auf dem Aufbau von internationalen Kapazitäten bei der Einschätzung des Gefahrenpotentials, sowie der Evaluierung von Sanierungsinstrumenten mit dem Ziel Handlungsempfehlungen für politische Entscheidungsträger abzuleiten.
Dabei knüpft BALTWRECK an bestehende Management-Tools und web-basierte Lösungen in Form einer Plattform an und entwickelt diese bedarfsgerecht weiter. Auf dieser Plattform sollen spezifische Daten der Ostsee gesammelt werden, um eine detaillierte und fallspezifische Risikobewertung zu ermöglichen. Zu den hierfür eingesetzten Technologien gehören geophysikalische Untersuchungen, chemische Analysen und biotechnologische Methoden zur Überwachung der Umwelt. Die Aufnahme eines breiten Spektrums an Daten soll eine ganzheitliche Bewertung der einzelnen Wracks und Munitionsfundstellen ermöglichen und eine Ableitung von individuellen Sanierungsoptionen vereinfachen.
Five central maritime use cases will be considered over the course of the project, from 1 January 2022 to 31 December 2024: Internet of Underwater Things (IoUT), Offshore Wind Energy, Munitions in the Sea, Biological Climate Protection, and Critical Infrastructure:

Projektdetails
-
Zeitrahmen: 1. Juli 2024 – 30. Juni 2027
-
Finanzierung: 3.8 Mio €
-
Ziel: Reduzierung oder Prävention der Verschmutzung der Ostsee durch gefährliche Chemikalien aus Munitionsresten und Schiffswracks

Projektzusammenfassung
Das BALTWRECK Projekt zielt darauf ab, die Verschmutzung der südlichen Ostsee durch gefährliche Chemikalien aus Munitionsresten und Schiffswracks zu reduzieren. Im Fokus stehen die Entwicklung, Erprobung und Umsetzung von Methoden für das Management von Wracks. Dazu gehören effiziente Diagnostikmethoden, in-situ-Sanierungstechnologien, sowie die Erprobung an Pilotstandorten. Zudem sollen Empfehlungen für politische Entscheidungsträger und lokale Verwaltungen formuliert werden, begleitet von Workshops, Konferenzen und Öffentlichkeitskampagnen, um das Bewusstsein für diese Problematik zu schärfen und die internationale Zusammenarbeit zu fördern.

Finanzierung
Interreg South Baltic - kofinanziert von der Europäischen Union
Unser Beitrag
Das BALTWRECK-Projekt wird von einem Konsortium aus führenden wissenschaftlichen Institutionen, Umweltbehörden und spezialisierten Unternehmen aus den Ostsee Anrainerstaaten Polen, Deutschland, Schweden und Litauen durchgeführt. Die Konsortialleitung übernehmen das Institut für Strömungsmaschinen (IMP PAN) und das Institut für Ozeanologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften (IO PAN), weitere Mitwirkende sind unter anderem das Umweltbundesamt (UBA), das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, sowie das Leibnitz-Institute für Ostseeforschung Waremünde (IOW).
north.io ist verantwortlich für das Management der gesammelten Daten sowie die Weiterentwicklung des web-basierten Entscheidungsunterstützungssystems und der darin enthaltenen Werkzeuge zur Risikobewertung und Priorisierung der Fundstellen. Dazu gehört das Anpassen des im North Sea Wrecks Projekt entwickelten Risikobewertungstools. Hierfür wird north.io mit den Kollegen der Universität Göteborg Chalmers den Ansatz zur Risikobewertung verfeinern und für die Gegebenheiten der Ostsee adaptieren. Um die Annahme und Nutzung der Plattform durch die verschiedenen Interessenvertreter zu fördern wird north.io zudem im Zusammenschluss mit anderen Projektpartner Workshops und Schulungen für die Nutzung der Plattform durchführen und damit die Verteilung und weitere Verwendung der Projektergebnisse auch nach Projektende anregen.

Project Partners


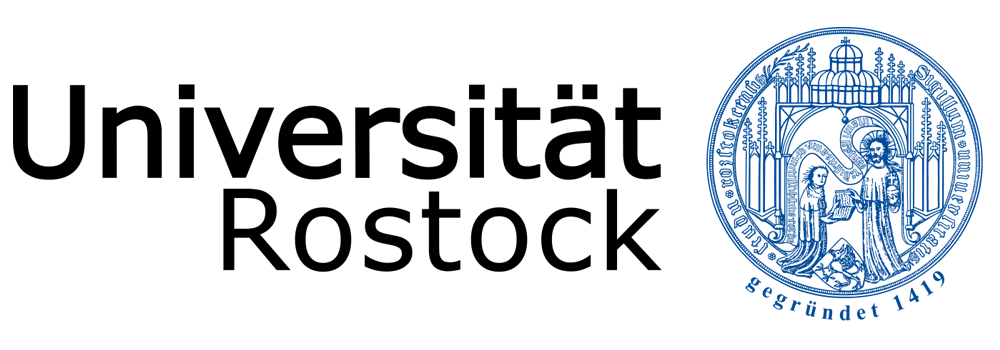

Associated Partners
Institute of Oceanology of Polish Academy of Science Association of Polish Communes Euroregion Baltic
Klaipeda University Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde
JT Ship Service Tomasz Jatkowski north.io GmbH
University of Gdańsk Institute of Toxicology, University Medical School Schleswig-Holstein
GEOMAR - Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel